
«Die Fachkräfte gehen uns aus, bevor uns das Geld ausgeht»
Die Kampagne ist von einigen kantonalen Ärztegesellschaften angestossen worden, weil deren Mitglieder zunehmend in Not kommen, ihre Patienten nicht mehr vollumfänglich versorgen zu können. Es geht im Kern darum, den direkten Arzt-Patienten-Kontakt, den Zugang zu Diagnostik und die Therapiefreiheit zu erhalten, die wir für eine optimale – nicht maximale! –, individuell abgestimmte Behandlung unserer Patientinnen und Patienten benötigen. Auch geht es darum, genügend Zeit für das Gespräch mit Patientinnen und Patienten, Angehörigen und anderen Medizinal- und Gesundheitsberufen zu haben. Durch den letzten bundesrätlichen Tarifeingriff wurde die Koordination durch den Hausarzt gleichsam abgeschafft, indem die Zeit dafür auf wenige Minuten pro Quartal zusammengestrichen wurde. Die Kampagne ist nötig und dringend geworden, weil der aktuelle Trend der Schweizer Gesundheitspolitik in die gegenteilige Richtung läuft, weil er uns durch immer mehr Bürokratie und ständig neue Auflagen immer mehr einschnürt und damit die Versorgungssicherheit gefährdet.
Es gibt verschiedene Beispiele – oder besser: Baustellen. Eine der grössten ist die Personalsituation in den Spitälern und in den Praxen, wo es überall und zunehmend an professionellen Fachkräften fehlt. Das betrifft die Pflege ebenso wie die Ärzteschaft. 20 Prozent der Praxen haben heute bereits einen Aufnahmestopp, was dazu beiträgt, dass immer mehr Patienten direkt die Notfallstationen der Spitäler aufsuchen. Dazu kommt: Ohne ausländische Ärzte könnten wir die Versorgung heute schon gar nicht mehr gewährleisten.
Das hat einerseits mit den Rahmenbedingungen fast aller Gesundheitsberufe zu tun, die durch bürokratische Auflagen immer unattraktiver werden. Anderseits wurde in der Schweiz die Nachwuchsförderung sträflich vernachlässigt, sowohl bei der Ärzteschaft als auch in der Pflege. Die Schweiz hat über Jahrzehnte nur zwei Drittel des Sollbestandes ausgebildet – aus Kostengründen. Kurz gesagt: Die Fachkräfte gehen uns aus, bevor uns das Geld ausgeht. Um den eigenen Nachwuchs zu fördern und zu motivieren, braucht es deutlich attraktivere Rahmenbedingungen.
Zum Beispiel mit flexibleren und kürzeren Arbeitszeiten. Die jungen Kolleginnen und Kollegen sind nicht mehr bereit, 70 oder mehr Stunden in der Woche zu arbeiten, wie zu meiner Zeit, weil es für sie nicht nur den Beruf, sondern auch noch ein Privatleben gibt, die Work-Life-Balance, das ist völlig legitim. Denn eigentlich gibt es ein Arbeitsgesetz, das eine 50-Stunden-Woche vorschreibt. Aber an dieses hält sich nicht mal der KUV-Bereich des BAG bei seinen Berechnungen.
Eine neue Offensive zur Förderung der Gesundheitsberufe muss sich an diesen Vorgaben orientieren. Ein anderes Thema ist die Rolle und Entlöhnung von MPK und MPA, die vor allem Praxis-Ärztinnen und -Ärzte entlasten könnten, indem diese gewisse Aufgaben an MPK in der Betreuung chronisch kranker Patienten delegieren könnten, um selber mehr Ressourcen für weitere Patientinnen und Patienten zu haben, damit diese nicht zwangsläufig die Notfallstationen aufsuchen müssen. Doch dazu fehlt vor allem die entsprechende Finanzierung über die Grundversicherung. Die Praxisärztinnen arbeiten heute mit einem Tarif, welcher seit 2004 nie mehr angepasst wurde, trotz medizinischer Entwicklung, steigender Infrastrukturkosten, Digitalisierung und eben auch steigender Löhne der medizinischen Praxisassistentinnen. Die bisher nicht erfolgte Genehmigung des TARDOC führt zu Mehrkosten, da dadurch die Handlungsmöglichkeiten in der günstigeren Hausarztmedizin weiterhin unzeitgemäss unnötig einschränkt bleiben und zwangsläufig auch deshalb vermehrt Patientinnen und Patienten Notfallstationen aufsuchen und dort behandelt werden, gleichsam als Überlaufreaktion.
Ja, die Medikamentenversorgung. Wir haben heute ein riesiges Medikamentenbeschaffungsproblem. Weil ein Teil der Medikamente in der Schweiz nicht mehr verfügbar ist, müssen Schweizer Ärztinnen und Ärzte diese heute im Ausland bestellen. Das betrifft neben den Medikamenten auch Impfstoffe und neu auch Medizinalprodukte. Neben einem «out of stock»-Problem, das nicht nur die Schweiz, sondern auch andere Länder haben, führt die aktuelle Gesundheitspolitik zu einer Verschärfung der «out of market»-Problematik, hausgemachtes Versagen mit fatalen Folgen.
Damit meine ich Aktivitäten auf europäischer Ebene. Weil der Schweizer Markt alleine zu klein ist, müsste man auf europäischer Ebene eine entsprechende Medikamentenautonomie anstreben – mit Beteiligung der Schweiz. Das setzt auf politischer Ebene eine gewisse Normalisierung der Beziehungen zur EU voraus. Die Schweizer Europapolitik darf nicht mehr zum Spielball parteipolitischer Interessen werden, die dann auf dem Buckel des Gesundheitswesens, der Forschung und der Schweizer Patientinnen und Patienten ausgetragen wird.
Es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage. Aber einige Entwicklungen lassen sich klar benennen. Der Verwaltungsapparat wird aufgebläht. Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) mit dem BAG wuchs seit der Übernahme durch Herrn Bundesrat Berset um rund 500 Vollzeitstellen, beziehungsweise um 24 Prozent, und beschäftigt heute rund 800 Spezialistinnen und Spezialisten. Dieser Apparat hält uns mit theoretisch und praxisfern erarbeiteten, manchmal auch politisch ideologisch geprägten Vorlagen auf Trab. Das führt zu einer dysfunktionalen Mikroregulierung, unter der übrigens auch andere Branchen leiden.
Dabei müsste die «Check and Balance» durch das Parlament gesichert werden. Im Schweizer Milizsystem sind aber immer mehr Politikerinnen und Politiker mit der Komplexität des Gesundheitssystems überfordert und tragen dann mit gut gemeinten eigenen und «einfachen» Lösungen ungewollt zur Malaise bei. Beispiele dafür sind die Zulassungsregulierung oder die Schaffung einer eidgenössischen Qualitätskommission.
Ja, es hat auch zu tun mit einem zunehmenden Klima des Misstrauens (des Staates und der Versicherer) gegenüber den Leistungserbringern und Pflegenden. Das äussert sich in immer mehr Kontrollen, die die Handlungsmöglichkeiten des Arztes und der Pflege gegenüber dem Patienten einschränken. Wir werden buchstäblich zugemüllt mit medizinisch sinnlosen Anfragen für Atteste, Berichte usw., zynischerweise auch noch unter dem Vorwand, dass diese zur Qualitätsverbesserung im Gesundheitswesen beitrügen. Das Gegenteil ist der Fall.
Ferner gehören dazu immer mehr Eingriffe in die medizinische Indikationsqualität durch Spitaldirektionen und Controller, welche unter ökonomischem Druck die medizinische Expertise übersteuern. Deutschland dient dabei offenbar immer noch als Vorbild, obwohl dort die Qualität bekannterweise gelitten hat. Dieser ökonomische Druck macht vor Ärztinnen und Ärzten nicht halt. Das ist eine Entwicklung, die wir stoppen müssen, denn sie widerspricht dem zentralen Credo ärztlicher Tätigkeit, das Bestmögliche für den Patienten zu machen. Und sie beschädigt das Vertrauen zwischen Arzt und Patient, die Basis jeder guten Arzt-Patienten-Beziehung. Deshalb stellt die Kampagne den Patienten in den Mittelpunkt ärztlicher Tätigkeit.
In der Schweiz dominieren zwei verschiedene politische Strömungen die Gesundheitspolitik, eine neoliberale und eine etatistische. Die Neoliberalen wollen das Gesundheitswesen dem Mechanismus des «freien Marktes» überlassen, der nach den Regeln von Angebot und Nachfrage funktionieren soll. Die Etatisten andrerseits wollen, dass das Gesundheitswesen vom Staat diktiert und jeder Arzt zum Staatsangestellten wird. Durch jede dieser beiden Strömungen wird eine Zweiklassenmedizin direkt oder indirekt mehr gefördert als durch das heutige austarierte System.
Ein weiterer Faktor ist die zunehmende Polarisierung in unserer Gesellschaft, die sich auch in der immer schwierigeren Kultur der Zusammenarbeit zwischen den Stakeholdern, auch Versicherern und Verbänden von Gesundheitsfachpersonen niederschlagen und Kompromisse schwierig machen. Das kann dann natürlich politisch auch genutzt werden im Sinne von «divide et impera». Eine altbekannte Strategie.
Konkret bedeutet eine Zweiklassenmedizin, dass immer mehr Leistungen aus der Grundversicherung entfernt und in die Zusatzversicherung verschoben werden, die sich nur noch reiche Menschen leisten können. Dabei «profitiert» einerseits der Staat von geringeren Kosten in der Grundversorgung, anderseits erhalten die Versicherer ein zusätzliches Geschäftsfeld, in dem sie grössere Gewinne und Profite einstreichen können.
Es ist keine Kampagne der FMH. Es ist eine Kampagne der Basisorganisationen, weshalb die FMH bewusst nicht an der Front der Kampagne in Erscheinung tritt, sie aber inhaltlich unterstützt.
Wegen des Kontaktes mit meinen Patienten und deren fast durchwegs positiven Rückmeldungen. Diese Feedbacks freuen mich nicht nur, sie geben mir auch die Kraft und Energie, die ich brauche, um die zunehmend schwierigeren Rahmenbedingungen des Berufes durchzustehen.
Was mir aber Sorge bereitet, sind die Perspektiven der jungen Generation von Ärztinnen und Ärzten. Diese wird mehr oder weniger schamlos im Gesundheitswesen ausgebeutet und mit administrativen Aufgaben im Spital überhäuft. Sie erleben und erfahren, dass ökonomische Entscheidungen die medizinischen übersteuern können und sie sich diesen unterordnen müssen. Sie können sich schlecht wehren, da sie in der Weiterbildung stehen und ihre Stellen auf ihrem Weg zum Facharzt häufig wechseln müssen. Sie empfinden die öffentliche Berichterstattung, häufig geprägt durch Versicherungsverbände oder politische Intentionen, als «Ärztebashing». Dabei erleben sie die Gefährdung der Versorgungssicherheit, die zunehmende Gewalt gegenüber dem Gesundheitspersonal, z.B. auf Notfallstationen, unmittelbar. In diesem Zusammenhang sei das nachfolgende Statement der European Jung Doctors allen zur Lektüre empfohlen.
Die Fragen stellte Bernhard Stricker.
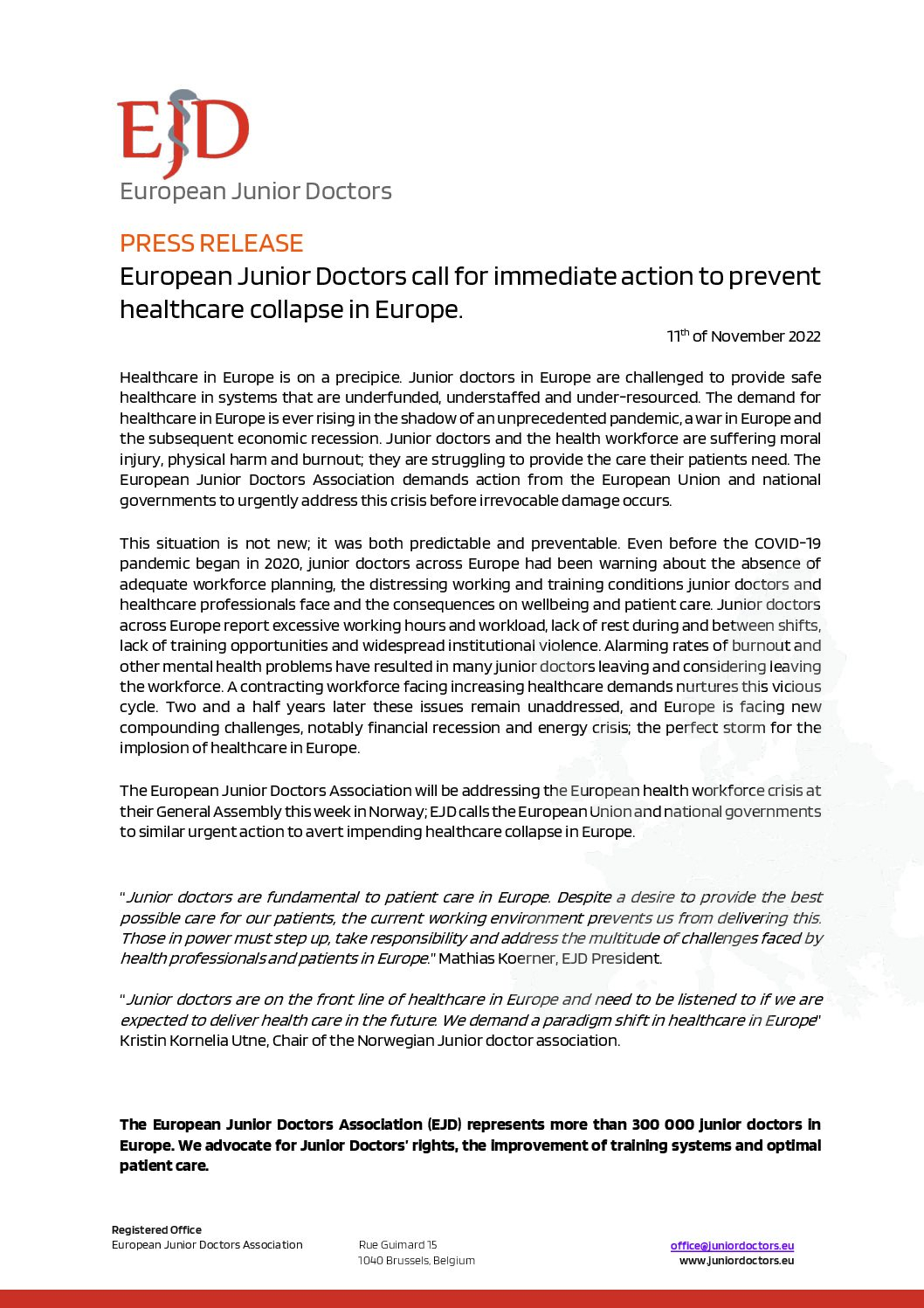

Mitglied ZV FMH und der Redaktion Synapse

Bernhard Stricker
Mitglied der Redaktion Synapse


